
Text und Fotos: Martin Schlu, Stand: 15. Mai 2025
Einführung
Geschichte
Ahlbeck
Benz
Bansin
Heringdorf
Koserow
Peenemünde
Usedom (Stadt)
Zirchow
Schloß Stolpe
außerhalb Usedoms:
Anklam
Wolgast
Koserow ist ein Dorf auf einer schmalen Landenge zwischen Zinnowitz und Ückeritz. Wie die Namen nahelegen, ist es kein mondänes Badeparadies, aber die Lage spricht die stilleren Besucher an. Der Ostseestrand ist der gleiche wie in Heringsdorf, doch das Hinterland ist interessanter.

Strand bei Lüttenort - am besten mit dem Fahrrad erreichbar
Das Achterwasser, eine Mischung aus Peene- und Oderwasser mit ein bißchen Ostsee, ist ein Paradies für Naturschützer und Paddler und weil es abseits der Hauptstraße keinen Trubel gibt, ist es wie geschaffen für stillere Menschen. Natürlich gibt es für Grundschulkindfamilien auch die übliche Bespaßung mit Karls Erlebnisdorf und in Zinnowitz das umgedrehte Haus und die Tauchgondel, aber dem kann man ja aus dem Weg gehen. Interessant ist in Koserow etwas ganz Anderes.

Weg vom Lüttenorter Museum zum Mellsee
Zwischen Koserow und Zempin an der B111 gibt es den kleinen Ort Lüttenort (= Ort des Kleinen). Dort liegt das Museumsatelier des Malers Otto Niemeyer-Holstein (11.5.1896 - 20.2.1984), der bei der Machtergreifung der Nazis 1933 schon ein arrivierter Maler war und internationale Kunstausstellungen gehabt hatte.
Niemeyer stammte aus einer musisch-künstlerischen Famile. Der Großvater, der Jurist und Mäzen Theodor Niemeyer, hatte Konzerte mit Johannes Brahms gespielt, Klavierabende mit Clara Schumann organisiert und war mit Richard Wagner befreundet gewesen. Der Vater, der Völkerrechtler Theodor Niemeyer, war ab 1888 Jura-Professor in Halle, ab 1893 in Kiel, noch später Rektor der Universität in Berlin. Der Sohn Otto hatte dagegen eher schulische Probleme und meldete sich 1914 als Freiwilliger zum Ersten Weltkrieg. Vom Krieg traumatisiert wurde er 1916 in ein Sanatorium im Schweizer Engadin gebracht, wo er zu malen begann. Er wurde zur künstlerischen Ausbildung nach Ascona geschickt. Dort lernte er seine erste Frau Herta Langwara kennen, außerdem Alexej von Jawlensky und dessen Freundin Marianne von Werefkin, die ihn beide künstlerisch beeinflußten. 1917 fügte er seinem Nachnamen den Geburtshinweis „Holstein“ hinzu. 1924 zerbrach die Ehe mit Herta, nachdem der Sohn Peter zur Welt gekommen war. (Roscher, S. 32ff)
Im gleichen Jahr gründete Niemyer-Holstein mit u. a. Alexej von Jawlensky die Malergruppe "Der große Bär“ in Ascona. Er war mit Lyonel Feininger bekannt, malte im Prinzip expressionistisch und lebte seit 1926 in Berlin. Geld verdiente er mit den Bildern kaum, sondern mit einer Bürotätigkeit. Ende 1927 heiratete er Annelise, die eine jüdische Mutter hatte und als „Halbjüdin“ galt, das gemeinsame Kind Günter als „Vierteljude“. Noch vor der Machtergreifung der Nazis wurde Niemeyer-Holstein klar, daß sein Malstil umstritten sein würde und er auf Dauer nicht in Berlin leben wollte. Bei Zinnowitz mietete er sich mit seiner Frau das erste Mal bei einem Bauern ein und kam regelmäßig nach Usedom zurück.
1932 hatte Niemyer-Holstein sich nach einem lukrativen Bilderverkauf an einer extremen Verengung des Landstreifens, zwischen Ostsee und Mellsee, ein Stück Brachland und einen alten Gepäckwagen der S-Bahn aus Berlin gekauft (RM 65,20), ihn auf dem Grundstück aufstellen lassen, und ab 1933 wohnte er den Sommer über darin. (Roscher, S. 11-25)
Die nächsten Jahre machte er das Stück Sandfläche urbar, schaufelte Schlick aus dem See auf seine Parzelle und nahm alles an organischem Dünger, was er auftreiben konnte - Pferdäpfel eingeschlossen. Bis 1939 hatte er noch etliche Ausstellungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, obwohl einige seiner Werke als „entartet“ galten und beschlagnahmt wurden. Trozdem war Niemeyer-Holstein gut im Geschäft und konnte sich leisten, seine Ferienwohnung als Atelier und Hauptwohnsitz auszubauen und ab 1939 auf Dauer dort zu wohnen. Ein angelegter, großer Garten bot ausreichend Platz für Skulpturen befreundeter Künstler.

Obern: Das Atelier „Tabu“ im Skulpturengarten
Ab 1936 versteckte die Familie Niemyer-Holstein Annelises Mutter in Lüttenort, weil sie in Berlin als Halbjüdin verhaftet worden wäre. Ab 1942 wurde in Peenemünde die „Wunderwaffe“ entwickelt. Man baute neben der Landstraße (heute die B111) eine Stromleitung dorthin und Niemeyer-Holstein konnte für sein Haus einen Anschluß legen und dies mit einem Bild bezahlen. Bis jetzt hatte die Familie mit Petroleum-Lampen Licht gehabt, geheizt und gekocht wurde mit Kohle und Holz.
Im gleichen Jahr waren Niemeyer-Holsteins Bilder aus den öffentlichen Museen abgehängt worden. Kompliziert war ein an der Straße eingerichteter ständiger Wachtposten, der auch Annelises Mutter in der Bewegung einschränkte, doch Niemyer-Holstein genoß zwischen den weiter entfernten Dörfern eine gewisse Narrenfreiheit und bis zum Kriegende war die Mutter hier sicher.
Unten: Skulpturen im Garten, im Hintergrund das Museum.

nach oben
Die Famiie hoffte ab 1942, daß sie in Lüttenort in Ruhe gelassen würde. Über den S-Bahn-Wagen wurden Gebäude errichtet und es entstand über Monate ein richtiges Haus, in dem mittlerweile bis zu fünf Personen lebten. Ein Jahr später steckte man Niemeyer-Holstein in eine Eisenbahnuniform, machte einen Schaffner aus ihm und ließ ihn als Eisenbahner arbeiten. Noch ein Jahr später starb der Sohn Peter (aus erster Ehe) bei einem Aufklärungsflug über dem Skagerrak.
Nach dem Krieg konnte Otto Niemeyer-Holstein wieder seine Bilder ausstellen, verkaufen und die Erträge in sein Haus investieren, das immer mehr um den Eisenbahnwaggon gebaut wurde, bis der nicht mehr zu erkennen war. Zu seinen Freunden zählten u.a. Oskar Kokoschka, Marc Chagall und viele von den Nazis verfemten Maler und Bildhauer, deren Werke er kaufte (und die im Museum ausgestellt werden).
1948 wurde die DDR gegründet und Niemeyer-Holstein arrangierte sich mit ihr und hatte in den Folgejahren viele Austellungen im In- und Ausland, obwohl 1953 alle seine Bilder für die Kunstausstellung in Dresden abgelehnt worden waren. 1964 wurde Niemeyer-Holstein zum Professor ernannt, 1969 wurde er er Mitglied der Akademie der Künste und galt ab da bis zu seinem Tod 1984 als einer der bedeutendsten deutschen Maler. Dies hinderte die Stasi allerdings nicht daran, ihn ab 1970 fortgesetzt zu observieren.
1974 bekam Niemeyer-Holstein den Nationalpreis der DDR der II. Klasse in Höhe von Mk 50.000, der es ihm ermöglichte, die alte Holländermühle in Benz zu kaufen und als Rückzugsraum zu benutzen. Heute kann man das Untergeschoß als Ausstellungsraum erleben - eine Kopie des 1910 entstandenen Feininger-Gemäldes dieser Mühle hängt dort ebenfalls.

Die Holländer-Mühle in Benz
nach oben
Eine 1982 gedrehte Filmbiographie beschreibt Niemeyer-Holstein als Arbeitstier, der jeden Tag am Ostseestrand spazieren ging und malte. Teile dieses Filmes hat das Museum auf youtube veröffentlicht.

Die große Ausstellungshalle des Museums
Otto Niemeyer-Holstein liegt mit seiner - kurz nach ihm verstorbenen - Frau Annelise auf dem Benzer Friedhof, in zweiter Reihe hinter der Altarwand der Friedhofskapelle. Die Statue neben dem gemeinsamen Grab weist auf den Standort der Holländermühle, die bis an sein Lebensende ein weiterer wichtiger Zufluchtsort für ihn war.

Das gemeinsame Grab von Anneliese und Otto Niemyer-Holstein. Zur Ansicht von Ottos Grabstein auf das Bild klicken.
Nach seinem Tod in Lüttenort 1984 wurden Haus und Garten im Wesentlichen so belassen, wie sie waren. Das Museum wurde eingerichtet und hier hat man die Möglichkeit viele Bilder an ihrem Entstehungsort zu betrachten.
Literatur
Achim Roscher: Lüttennort. Das Bilder-Leben und Bild-Erleben des Malers Otto Niemeyer-Holstein nach seinem Erzählen wiedergegeben. Verlag der Nationen, Berlin (DDR) 1989, ISBN 3-373-00237-0 (antiquarisch).
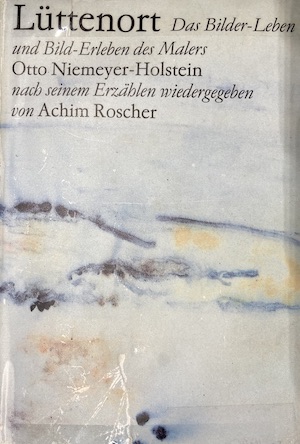
Lüttenort - das Buch von Achim Roscher
Bilder von Otto Niemeyer-Holstein auf artnet
nach oben